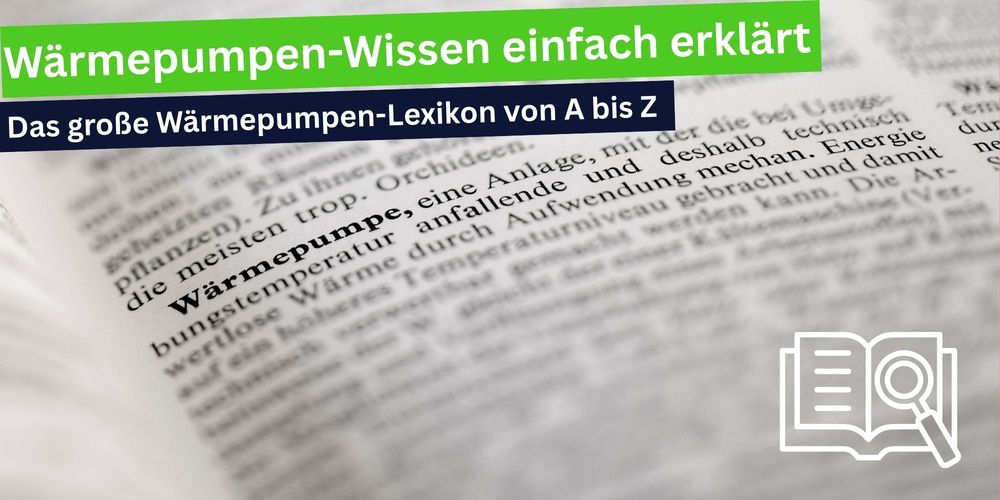Wärmepumpen-Wissen: Fachbegriffe rund um Wärmepumpentechnik, Installation und Förderung in Österreich
Das umfassende Wärmepumpen-Lexikon mit allen wichtigen Begriffen rund um Luft-Wasser-, Sole-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen, Heizungstechnik und Förderungen in Österreich.
Unser Glossar wird laufend erweitert und aktualisiert. Vermissen Sie dennoch einen Begriff? Schreiben Sie uns einfach an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! – wir fügen ihn gerne hinzu.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Absorptionswärmepumpe
Eine Absorptionswärmepumpe nutzt anstelle eines elektrischen Kompressors einen thermischen Verdichter, der mit Wärme (Gas, Öl oder Fernwärme) betrieben wird. Sie arbeitet mit einem Lösungsmittelkreislauf (meist Ammoniak-Wasser oder Lithiumbromid-Wasser) und eignet sich besonders für größere Gebäude oder industrielle Anwendungen. In Österreich werden sie oft in Kombination mit Fernwärme oder als gasbetriebene Systeme eingesetzt. Der Vorteil liegt in der geringen elektrischen Leistungsaufnahme und der Möglichkeit, vorhandene Gasanschlüsse zu nutzen.
Wärmepumpentarif
Wärmepumpentarife sind spezielle Stromtarife für Wärmepumpen mit günstigeren Preisen als der normale Haustarif. In Österreich bieten alle großen Energieversorger solche Tarife an, oft gekoppelt mit Sperrzeiten von bis zu 6 Stunden täglich. Die Ersparnis liegt meist zwischen 2-4 Cent/kWh gegenüber dem Standardtarif. Voraussetzung ist ein separater Zähler oder ein Smart Meter mit registrierender Leistungsmessung. Bei hohen Jahresverbräuchen können die Einsparungen mehrere hundert Euro betragen.
Sperrzeiten
Sperrzeiten sind Zeiträume, in denen Netzbetreiber Wärmepumpen bei besonderen Netzbelastungen ferngesteuert abschalten können. In Österreich sind bis zu 3 Sperrzeiten à 2 Stunden täglich üblich, dafür erhalten Kunden günstige Wärmepumpentarife. Moderne Smart Grid Ready Wärmepumpen können diese Zeiten automatisch überbrücken, indem sie vorher Pufferspeicher aufladen. Bei gut dimensionierten Anlagen mit ausreichend Speichermasse sind Sperrzeiten meist unbemerkt überbrückbar.
Sektorkopplung
Sektorkopplung bezeichnet die Verknüpfung der Energiesektoren Strom, Wärme und Mobilität zur effizienten Nutzung erneuerbarer Energien. Wärmepumpen spielen eine zentrale Rolle, da sie elektrische Energie aus Wind und Solar in Wärme umwandeln. In Österreich wird Sektorkopplung durch Power-to-Heat-Strategien und intelligente Netze vorangetrieben. Die Kombination von Wärmepumpen mit PV-Anlagen und Elektromobilität ermöglicht eine weitgehend dekarbonisierte Energieversorgung.
Power-to-Heat
Power-to-Heat bezeichnet die Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme, besonders im Kontext der Sektorkopplung und Energiewende. Wärmepumpen sind eine effiziente Form von Power-to-Heat, da sie aus einer Kilowattstunde Strom mehrere Kilowattstunden Wärme erzeugen. In Österreich wird Power-to-Heat wichtiger für die Integration erneuerbarer Energien, da Wärmepumpen Überschussstrom aus Wind und Solar nutzen können. Smart Grid Ready Wärmepumpen können netzdienlich gesteuert werden und zur Netzstabilität beitragen.
PV-Integration
Die Integration von Photovoltaik-Anlagen mit Wärmepumpen optimiert den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Solarstroms. Moderne Wärmepumpen können bei PV-Überschuss bevorzugt laufen und dabei Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher aufladen. In Österreich wird diese Kombination durch spezielle Tarife und Smart Grid Ready Funktionen gefördert. Energy Management Systeme können die Wärmepumpe so steuern, dass sie möglichst viel günstigen PV-Strom nutzt und teure Netzbezugszeiten meidet.
Elektrische Zusatzheizung
Die elektrische Zusatzheizung (Elektroheizstab) unterstützt die Wärmepumpe bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder hohem Warmwasserbedarf. Sie ist meist im Pufferspeicher oder in der Wärmepumpe integriert und schaltet sich automatisch zu. In gut geplanten Anlagen sollte sie nur an wenigen Tagen im Jahr benötigt werden. In Österreich darf sie bei monovalentem Betrieb maximal 5% der Jahresheizarbeit leisten, um optimale Förderungen zu erhalten.
EHPA-Gütesiegel
Das EHPA-Gütesiegel der European Heat Pump Association kennzeichnet qualitativ hochwertige Wärmepumpen, die strenge technische Anforderungen erfüllen. Zertifizierte Geräte durchliefen umfangreiche Prüfungen bezüglich Effizienz, Schallverhalten und Qualität. Viele österreichische Förderstellen akzeptieren nur Wärmepumpen mit EHPA-Gütesiegel oder vergleichbaren Zertifikaten. Es gewährleistet dem Verbraucher geprüfte Leistungsdaten und Qualitätsstandards.
Energieausweis
Der Energieausweis ist ein Dokument, das den Energiebedarf oder -verbrauch eines Gebäudes ausweist. In Österreich ist er für die meisten Förderungen von Wärmepumpen erforderlich und dient als Nachweis für die energetische Qualität des Gebäudes. Der Heizwärmebedarf (HWB) aus dem Energieausweis ist wichtig für die korrekte Dimensionierung der Wärmepumpe. Bei Sanierungen kann durch den Einbau einer Wärmepumpe oft eine bessere Energieausweisklasse erreicht werden.
Abtauung
Die Abtauung ist ein automatischer Prozess bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, bei dem sich bildende Eisschichten am Verdampfer entfernt werden. Bei Außentemperaturen unter 5°C und hoher Luftfeuchtigkeit kann der Verdampfer vereisen, was die Effizienz reduziert. Moderne Wärmepumpen erkennen dies automatisch und kehren kurzzeitig den Kältemittelkreislauf um (Hot-Gas-Abtauung). In österreichischen Wintern ist eine effiziente Abtauung besonders wichtig für die Betriebssicherheit.
Amortisationszeit
Die Amortisationszeit gibt an, nach wie vielen Jahren sich die Investition in eine Wärmepumpe durch eingesparte Energiekosten refinanziert hat. In Österreich liegt sie typischerweise zwischen 10-15 Jahren, abhängig von der ersetzten Heizung, den Energiepreisen und der genutzten Förderung. Mit den aktuellen Förderungen der KPC (Kommunalkredit Public Consulting) und der Länder sowie steigenden Preisen für fossile Brennstoffe verkürzt sich die Amortisationszeit deutlich.
Arbeitszahl
Die Arbeitszahl beschreibt das Verhältnis der abgegebenen Heizwärme zur aufgenommenen elektrischen Energie über einen bestimmten Zeitraum (meist ein Jahr). Sie berücksichtigt alle realen Betriebsbedingungen wie Witterung, Gebäudeverhalten und Regelung. Eine gute Wärmepumpe erreicht in österreichischen Verhältnissen Arbeitszahlen zwischen 3,5 und 5,5. Die Arbeitszahl ist aussagekräftiger als der COP, da sie den tatsächlichen Jahresbetrieb widerspiegelt.
Austria Gütesiegel Wärmepumpe
Das Austria Gütesiegel Wärmepumpe wird vom Verband Wärmepumpe Austria vergeben und kennzeichnet qualitativ hochwertige Wärmepumpensysteme, die spezielle Anforderungen erfüllen. Ausgezeichnete Geräte müssen unter anderem eine Mindest-COP von 4,0 bei A2/W35 erreichen und strenge Qualitätskriterien erfüllen. Das Gütesiegel hilft Verbrauchern bei der Auswahl zuverlässiger Systeme und ist oft Voraussetzung für maximale Förderungen in Österreich.
B
Brauchwarmwasser
Brauchwarmwasser bezeichnet das erwärmte Trinkwasser für den täglichen Gebrauch (Duschen, Baden, Spülen). Wärmepumpen können effizient Brauchwarmwasser bereiten, entweder über einen integrierten Warmwasserspeicher oder einen separaten Boiler. Moderne Wärmepumpen-Systeme erreichen Warmwassertemperaturen von 55-60°C, was für die Legionellenprophylaxe ausreichend ist. In Österreich wird die Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen besonders gefördert.
Bivalente Betriebsweise
Bei der bivalenten Betriebsweise wird die Wärmepumpe mit einem zweiten Wärmeerzeuger (meist Gas- oder Ölkessel) kombiniert. Dies geschieht entweder bivalent-alternativ (ab einer bestimmten Außentemperatur übernimmt der Zusatzheizung) oder bivalent-parallel (beide Systeme arbeiten gleichzeitig). In Österreich ist diese Lösung bei älteren, weniger gedämmten Gebäuden oder in sehr kalten Regionen sinnvoll und wird entsprechend gefördert.
Bivalenzpunkt
Der Bivalenzpunkt ist die Außentemperatur, ab der eine Wärmepumpe alleine nicht mehr den gesamten Heizwärmebedarf decken kann und ein Zusatzheizgerät zugeschaltet werden muss. Typische Bivalenzpunkte liegen in Österreich zwischen -5°C und -10°C. Eine gute Anlagenplanung definiert den wirtschaftlich optimalen Bivalenzpunkt, bei dem die Wärmepumpe etwa 80-90% der jährlichen Heizarbeit übernimmt.
Brauchwarmwasser-Wärmepumpe
Eine Brauchwarmwasser-Wärmepumpe ist speziell für die Warmwasserbereitung konzipiert und nutzt meist die Raumluft, Abluft oder Außenluft als Wärmequelle. Sie besteht aus einem Wärmepumpenaggregat und einem integrierten Warmwasserspeicher (meist 200-300 Liter). Diese Systeme erreichen Jahresarbeitszahlen von 2,5-3,5 und sind besonders in Kombination mit PV-Anlagen oder in Gebäuden mit kontrollierten Lüftungsanlagen effizient.
C
COP (Coefficient of Performance)
Der COP ist eine Kennzahl für die Effizienz einer Wärmepumpe bei bestimmten Normprüfbedingungen. Er gibt das Verhältnis von abgegebener Heizleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung an. Übliche Bezeichnungen sind A2/W35 (Außenluft 2°C, Vorlauftemperatur 35°C) oder B0/W35 (Sole 0°C, Vorlauftemperatur 35°C). Hocheffiziente Wärmepumpen erreichen COP-Werte von 4,0-6,0. Für österreichische Förderungen sind meist Mindest-COP-Werte vorgeschrieben.
CO₂-Wärmepumpe
CO₂-Wärmepumpen verwenden Kohlendioxid (R744) als natürliches Kältemittel. CO₂ ist umweltfreundlich (GWP = 1), nicht brennbar und ungiftig. Diese Wärmepumpen arbeiten transkritisch und erreichen sehr hohe Warmwassertemperaturen (bis 90°C). Sie eignen sich besonders für Anwendungen mit hohem Warmwasserbedarf oder Sanierungen mit Radiatoren. In Österreich gewinnen CO₂-Wärmepumpen aufgrund der Umweltfreundlichkeit und der F-Gas-Verordnung an Bedeutung.
D
Direktverdampfung
Bei der Direktverdampfung zirkuliert das Kältemittel direkt durch in der Erde verlegte Kupferleitungen, ohne Zwischenkreislauf mit Sole. Dies ermöglicht höhere Effizienz, da ein Wärmetauscher entfällt. Allerdings sind größere Kältemittelmengen erforderlich und die Installation ist aufwendiger. In Österreich ist diese Technik weniger verbreitet als Sole-Wasser-Systeme, kann aber bei entsprechenden Bodenverhältnissen sehr effizient sein.
Dimensionierung
Die korrekte Dimensionierung einer Wärmepumpe ist entscheidend für Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Grundlage ist die Heizlastberechnung nach ÖNORM EN 12831. Überdimensionierte Anlagen haben häufige Taktvorgänge und schlechte Jahresarbeitszahlen, unterdimensionierte Anlagen erreichen nicht die gewünschten Raumtemperaturen. In Österreich sollte die Dimensionierung bei monovalentem Betrieb auf die Norm-Außentemperatur (-10°C bis -16°C je nach Region) ausgelegt werden.
E
Erdkollektoranlage
Erdkollektoren sind horizontal in 1,2-1,5 m Tiefe verlegte Rohrleitungen, in denen die Wärmeträgerflüssigkeit (Sole) zirkuliert. Sie nutzen die oberflächennahe Erdwärme und benötigen etwa das 1,5- bis 2-fache der beheizten Fläche als Kollektorfläche. In Österreich sind sie eine beliebte Alternative zu Tiefenbohrungen, besonders wenn ausreichend Gartenfläche vorhanden ist. Die verlegte Fläche darf nicht überbaut oder tiefgehend bepflanzt werden.
Erdsonde
Eine Erdsonde ist ein vertikal in die Erde eingebrachtes Rohrsystem für Sole-Wasser-Wärmepumpen. Die Sonden werden meist 80-150 m tief gebohrt und nutzen die konstante Erdtemperatur. Pro kW Heizleistung werden etwa 15-20 m Sondenlänge benötigt. In Österreich ist für Erdsonden meist eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich. Sie bieten ganzjährig gleichmäßige Temperaturen und ermöglichen auch passive Kühlung im Sommer.
Erdwärmepumpe
Erdwärmepumpen (Sole-Wasser-Wärmepumpen) nutzen die im Erdreich gespeicherte Sonnenwärme über Erdkollektoren oder Erdsonden. Sie zeichnen sich durch gleichmäßige Quelltemperaturen und hohe Jahresarbeitszahlen (4,0-5,5) aus. In Österreich sind sie sehr beliebt, da die Erdtemperatur konstant bei 8-12°C liegt und auch passive Kühlung möglich ist. Je nach System ist eine wasserrechtliche Bewilligung oder Anzeige bei der Behörde erforderlich.
F
F-Gase-Verordnung
Die F-Gase-Verordnung der EU regelt den Umgang mit fluorierten Treibhausgasen (F-Gasen), zu denen viele Kältemittel gehören. Sie sieht eine schrittweise Reduzierung von Kältemitteln mit hohem Treibhauspotential vor. In Österreich bedeutet dies einen verstärkten Einsatz natürlicher Kältemittel (Propan, Ammoniak, CO₂) oder neuer synthetischer Kältemittel mit geringem GWP. Die Verordnung beeinflusst die Kältemittelpreise und -verfügbarkeit erheblich.
Fußbodenheizung
Fußbodenheizungen sind ideale Wärmeabgabesysteme für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen (28-35°C) arbeiten. Dies ermöglicht hohe Effizienz und Komfort. In Österreich sind sie bei Neubauten Standard und werden auch bei Sanierungen oft nachgerüstet. Fußbodenheizungen bieten gleichmäßige Wärmeverteilung, geringe Luftzirkulation und können auch zur passiven Kühlung genutzt werden. Die Kombination mit Wärmepumpen wird besonders gefördert.
G
GWP (Global Warming Potential)
Das Global Warming Potential gibt das Treibhauspotential eines Kältemittels im Vergleich zu CO₂ an. CO₂ hat per Definition ein GWP von 1. Ältere Kältemittel wie R410A haben ein GWP von 2088, während neue umweltfreundliche Kältemittel wie R290 (Propan) ein GWP von 3 aufweisen. Die F-Gase-Verordnung strebt eine Reduktion der GWP-Werte an. In Österreich werden zunehmend Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln (niedriges GWP) gefördert.
Grundwasserwärmepumpe
Grundwasserwärmepumpen nutzen das Grundwasser als Wärmequelle über einen Förder- und einen Schluckbrunnen. Sie erreichen sehr hohe Jahresarbeitszahlen (5,0-6,0), da Grundwasser ganzjährig Temperaturen von 8-12°C aufweist. In Österreich ist eine wasserrechtliche Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz erforderlich. Voraussetzungen sind ausreichende Grundwasserführung, gute Wasserqualität und entsprechende geologische Verhältnisse. Sie eignen sich besonders für größere Objekte mit hohem Wärmebedarf.
H
Heizgrenztemperatur
Die Heizgrenztemperatur ist die Außentemperatur, unterhalb derer eine Heizungsanlage eingeschaltet wird. Sie liegt typischerweise zwischen 12-18°C und kann bei modernen Wärmepumpen witterungsgeführt gesteuert werden. In österreichischen Klimaverhältnissen ist eine intelligente Regelung wichtig, um Energieverschwendung zu vermeiden und trotzdem den Komfort zu gewährleisten. Moderne Wärmepumpen können die Heizgrenztemperatur automatisch an die Gebäudeeigenschaften anpassen.
Heizkurve
Die Heizkurve definiert das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur der Heizung. Eine korrekt eingestellte Heizkurve ist für die Effizienz der Wärmepumpe entscheidend. Sie wird meist über eine mathematische Funktion (Steilheit und Niveau) definiert und an das spezifische Gebäude angepasst. In österreichischen Gebäuden sind typische Heizkurven 0,8-1,4 bei gut gedämmten Neubauten und 1,2-2,0 bei sanierten Altbauten. Eine zu steile Heizkurve verschlechtert die Effizienz erheblich.
Heizlastberechnung
Die Heizlastberechnung nach ÖNORM EN 12831 ermittelt die benötigte Heizleistung eines Gebäudes bei Norm-Außentemperatur. Sie berücksichtigt Transmissionswärmeverluste, Lüftungswärmeverluste und interne Wärmegewinne. In Österreich ist sie Grundlage für die korrekte Dimensionierung der Wärmepumpe und oft Voraussetzung für Förderungen. Die Berechnung sollte raumweise erfolgen und klimatische Bedingungen des Standorts berücksichtigen (-10°C bis -16°C je nach Höhenlage und Region).
Heizstab
Ein Heizstab ist eine elektrische Zusatzheizung, die in Pufferspeichern oder Wärmepumpen integriert wird. Er dient als Backup bei sehr niedrigen Außentemperaturen, zur schnellen Warmwasserbereitung oder zur Legionellenschaltung. In Österreich sollten gut ausgelegte Wärmepumpen-Anlagen den Heizstab nur an wenigen Tagen im Jahr benötigen. Moderne Systeme regeln den Heizstab intelligent und nutzen ihn bevorzugt bei günstigen Strompreisen oder PV-Überschuss.
Hochtemperatur-Wärmepumpe
Hochtemperatur-Wärmepumpen können Vorlauftemperaturen von 65-80°C erreichen und eignen sich für Bestandssanierungen mit Radiatoren. Sie nutzen meist spezielle Kältemittel oder mehrstufige Verdichtung. In Österreich sind sie wichtig für die Heizungsmodernisierung in älteren Gebäuden, wo nicht immer eine Niedertemperatur-Heizflächen nachgerüstet werden können. Trotz der hohen Temperaturen erreichen moderne Geräte noch akzeptable Effizienzwerte und werden entsprechend gefördert.
Hybridwärmepumpe
Hybridwärmepumpen kombinieren eine Wärmepumpe mit einem Gas- oder Ölbrennwertkessel in einem Gerät. Die integrierte Regelung entscheidet automatisch über den effizientesten Betrieb je nach Außentemperatur und Energiepreisen. In Österreich sind sie eine gute Lösung für die schrittweise Dekarbonisierung, besonders in schlecht gedämmten Bestandsgebäuden. Sie ermöglichen den Umstieg von rein fossilen Systemen und können später zu monovalenten Wärmepumpen erweitert werden.
I
Inverter-Technologie
Inverter-Wärmepumpen können ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen, indem die Drehzahl des Kompressors variiert wird. Dies führt zu geringeren Taktvorgängen, höherer Effizienz und besserem Komfort. In Österreich sind sie Standard bei hochwertigen Anlagen, da sie besonders bei Teillastbetrieb (der größte Teil der Heizperiode) sehr effizient arbeiten. Inverter-Wärmepumpen erreichen höhere Jahresarbeitszahlen und arbeiten leiser als Geräte mit fixer Leistung.
J
Jahresarbeitszahl (JAZ)
Die Jahresarbeitszahl ist das Verhältnis der über ein Jahr abgegebenen Nutzwärme zur aufgenommenen elektrischen Energie. Sie berücksichtigt alle Betriebszustände, Regelungseinflüsse und realen Klimabedingungen. In Österreich sollten gut geplante Wärmepumpen-Anlagen JAZ-Werte zwischen 4,0 und 5,5 erreichen. Die JAZ ist das wichtigste Kriterium für die Bewertung der tatsächlichen Effizienz einer Anlage und oft Fördervoraussetzung. Sie kann durch Monitoring über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr bestimmt werden.
K
Kältemittel
Kältemittel ist der Stoff, der in der Wärmepumpe zirkuliert und den Wärmetransport ermöglicht. Es wechselt zwischen gasförmigem und flüssigem Zustand und transportiert dabei Wärme. Übliche Kältemittel sind R410A, R32, R290 (Propan) und R744 (CO₂). In Österreich erfolgt aufgrund der F-Gas-Verordnung eine Umstellung auf umweltfreundlichere Alternativen mit niedrigem Treibhauspotential. Die Wahl des Kältemittels beeinflusst Effizienz, Umweltverträglichkeit und Sicherheitsanforderungen.
Kältekreislauf
Der Kältekreislauf ist das Grundprinzip jeder Wärmepumpe: Das Kältemittel verdampft bei niedriger Temperatur im Verdampfer (nimmt Wärme aus der Umgebung auf), wird im Kompressor verdichtet und erwärmt, verflüssigt sich im Kondensator (gibt Wärme an das Heizsystem ab) und entspannt sich im Expansionsventil wieder. Dieser geschlossene Kreislauf ermöglicht den Transport von Wärme von einem niedrigen auf ein höheres Temperaturniveau. Die Effizienz hängt von der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und -senke ab.
Kompressor
Der Kompressor (Verdichter) ist das Herzstück der Wärmepumpe und verdichtet das gasförmige Kältemittel, wodurch sich dessen Temperatur erhöht. Übliche Bauformen sind Scroll-, Kolben- oder Schraubenverdichter. Moderne Kompressoren arbeiten oft mit Inverter-Technologie für variable Drehzahl. In Österreich sind besonders leise und effiziente Kompressoren gefragt. Die Lebensdauer liegt typischerweise bei 15-20 Jahren, und regelmäßige Wartung ist für optimale Funktion wichtig.
KPC (Kommunalkredit Public Consulting)
Die KPC ist die Förderabwicklungsstelle des Bundes für Umwelt- und Energieprojekte in Österreich. Sie verwaltet Programme wie "Raus aus Öl und Gas", thermische Sanierung und Förderungen für erneuerbare Energiesysteme. Wärmepumpen-Förderungen der KPC können online beantragt werden und betragen bis zu 7.500€ für den Heizungstausch. Die KPC prüft die technischen Voraussetzungen und wickelt die Förderauszahlung ab. Aktuelle Förderrichtlinien und Antragsformulare finden sich auf der Website der KPC umweltfoerderung.at/.
Kühlung mit Wärmepumpe
Moderne Wärmepumpen können im Sommer zur Kühlung genutzt werden, entweder aktiv (durch Umkehr des Kältekreislaufs) oder passiv (durch direkte Kühlung über Erdreich oder Grundwasser). Passive Kühlung ist besonders effizient und nutzt die niedrige Erdtemperatur. In Österreich gewinnt die Kühlfunktion aufgrund zunehmender Sommerhitze an Bedeutung. Fußbodenheizungen können auch als Kühlsystem genutzt werden, wobei auf Kondensatbildung geachtet werden muss.
L
Luftwärmepumpe
Luftwärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpen) nutzen die Außenluft als Wärmequelle und sind die am häufigsten installierte Wärmepumpenart in Österreich. Sie benötigen keine Erdarbeiten oder Genehmigungen und sind kostengünstig in der Anschaffung. Die Effizienz hängt stark von der Außentemperatur ab, moderne Geräte arbeiten aber auch bei -20°C noch zuverlässig. In österreichischen Klimaverhältnissen erreichen sie Jahresarbeitszahlen von 3,5-4,5. Wichtig ist die lärmoptimierte Aufstellung und korrekte Dimensionierung.
Luft-Luft-Wärmepumpe
Luft-Luft-Wärmepumpen (Klimageräte mit Heizfunktion) erwärmen direkt die Raumluft und arbeiten meist als Split-Geräte. Sie eignen sich für die Beheizung einzelner Räume oder gut gedämmter Gebäude mit geringem Heizwärmebedarf. In Österreich sind sie eine kostengünstige Lösung für Niedrigenergie- oder Passivhäuser, können aber keine zentrale Warmwasserbereitung übernehmen. Multi-Split-Systeme können mehrere Räume versorgen und bieten auch Kühlfunktion.
Leistungszahl
Die Leistungszahl (COP - Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis von abgegebener Heizleistung zu aufgenommener elektrischer Leistung bei bestimmten Betriebsbedingungen an. Sie wird unter Normprüfbedingungen gemessen (z.B. A2/W35 oder B0/W35) und ermöglicht den Vergleich verschiedener Wärmepumpen. In Österreich sind für Förderungen meist Mindest-COP-Werte vorgeschrieben. Die Leistungszahl ist ein theoretischer Wert, während die Jahresarbeitszahl die reale Effizienz über ein ganzes Jahr beschreibt.
Legionellenschutz
Legionellenschutz ist besonders bei Warmwasserspeichern wichtig, da sich Legionellen bei Temperaturen zwischen 25-50°C vermehren. Wärmepumpen sollten das Brauchwarmwasser regelmäßig auf mindestens 55°C erhitzen können. In Österreich ist bei größeren Anlagen (>400 Liter oder >3 Liter Rohrleitungsinhalt) eine regelmäßige Legionellenprüfung vorgeschrieben. Moderne Wärmepumpen haben automatische Legionellenschaltungen, die den Speicher periodisch aufheizen. Alternativ können thermische Desinfektion oder UV-Anlagen eingesetzt werden.
M
Monoblock-Wärmepumpe
Monoblock-Wärmepumpen haben alle kältetechnischen Komponenten in einem Außengerät vereint. Zum Gebäude führen nur Heizwasserleitungen, wodurch keine Kältemittelleitungen und kein Kältetechniker für die Inbetriebnahme erforderlich sind. In Österreich sind sie besonders bei Sanierungen beliebt, da der Installationsaufwand geringer ist. Sie sind frostsicher konstruiert und arbeiten mit einem internen Frostschutzkreislauf. Der Nachteil können etwas höhere Wärmeverluste der Wasserleitungen sein.
Monovalente Betriebsweise
Bei monovalentem Betrieb deckt die Wärmepumpe den gesamten Heizwärmebedarf alleine ab, meist unterstützt nur durch einen integrierten elektrischen Heizstab für Spitzenlasten. Dies ist der Standard bei gut gedämmten Gebäuden und modernen Wärmepumpen in Österreich. Voraussetzung ist eine korrekte Dimensionierung und ein gut gedämmtes Gebäude mit Niedertemperatur-Heizsystem. Monovalente Anlagen erreichen die höchsten Fördersätze und bieten komplette Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen.
Monitoring
Monitoring bezeichnet die kontinuierliche Überwachung und Aufzeichnung der Betriebsdaten einer Wärmepumpenanlage. Moderne Systeme erfassen Temperaturen, Laufzeiten, Stromverbrauch und Wärmemengen. In Österreich ist Monitoring wichtig für die Betriebsoptimierung, Störungsfrüherkennung und den Nachweis der Fördervoraussetzungen. Intelligente Systeme ermöglichen Fernüberwachung und -steuerung über Internet-Portale oder Apps. Das Monitoring hilft auch bei der Bestimmung der realen Jahresarbeitszahl und der Identifikation von Optimierungspotentialen.
N
Nachrüstung
Die Nachrüstung einer Wärmepumpe in bestehenden Gebäuden erfordert meist Anpassungen am Heizsystem. Ideal sind Niedertemperatur-Wärmflächen wie Fußbodenheizung oder große Radiatoren. In Österreich ist oft eine Kombination aus verbesserter Gebäudedämmung und Heizsystemanpassung nötig. Bei der Nachrüstung müssen auch Stromversorgung, Aufstellplatz und Schallschutz beachtet werden. Hochtemperatur-Wärmepumpen ermöglichen auch die Nachrüstung bei bestehenden Radiatoren ohne umfangreiche Umbaumaßnahmen.
Niedertemperatur-Heizsystem
Niedertemperatur-Heizsysteme arbeiten mit Vorlauftemperaturen unter 55°C und sind optimal für Wärmepumpen geeignet. Dazu gehören Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen sowie große Radiatoren. Sie ermöglichen hohe Effizienz der Wärmepumpe durch geringe Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und -senke. In Österreich werden sie bei Neubauten standardmäßig eingesetzt und bei Sanierungen oft nachgerüstet. Die großflächigen Wärmeabgabesysteme sorgen für hohen thermischen Komfort und gleichmäßige Temperaturen.
Norm-Außentemperatur
Die Norm-Außentemperatur ist die tiefste Außentemperatur, die für die Heizlastberechnung und Dimensionierung der Heizungsanlage zugrunde gelegt wird. Sie variiert in Österreich je nach Höhenlage und geografischer Lage zwischen -10°C (Städte im Osten) und -16°C (alpine Regionen). Diese Temperatur wird statistisch nur an wenigen Tagen im Jahr erreicht oder unterschritten. Die korrekte Berücksichtigung der örtlichen Norm-Außentemperatur ist wichtig für eine wirtschaftliche Dimensionierung der Wärmepumpe.
Netzrückwirkung
Netzrückwirkungen entstehen durch den Anlaufstrom von Wärmepumpen-Kompressoren, der das Stromnetz kurzzeitig belasten kann. Besonders bei schwächeren Netzanschlüssen können Spannungsschwankungen auftreten. Moderne Inverter-Wärmepumpen haben deutlich geringere Netzrückwirkungen als herkömmliche Geräte mit direktem Netzanlauf. In Österreich sind bei größeren Anlagen Netzverträglichkeitsnachweise erforderlich. Sanftanläufe oder spezielle Anlaufstrombegrenzer können die Netzbelastung reduzieren.
O
ÖNORM EN 14511
Die ÖNORM EN 14511 definiert die Prüfverfahren und Leistungsangaben für Luft- und Wasserwärmepumpen in Österreich. Sie legt die standardisierten Prüfbedingungen fest (z.B. A2/W35, B0/W35) unter denen COP-Werte gemessen werden. Diese europäische Norm gewährleistet vergleichbare Leistungsangaben verschiedener Hersteller und ist Grundlage für Förderungen und Zertifizierungen. Sie definiert auch Anforderungen an die Kennzeichnung und technische Dokumentation von Wärmepumpen.
P
Pufferspeicher
Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Wasserbehälter, der Heizwärme zwischenspeichert und die hydraulische Trennung zwischen Wärmepumpe und Heizsystem ermöglicht. Er reduziert die Takthäufigkeit der Wärmepumpe, gleicht Lastspitzen aus und ermöglicht die Integration verschiedener Wärmequellen. In Österreich sind Pufferspeicher bei den meisten Wärmepumpen-Anlagen Standard, da sie die Effizienz erhöhen und den Betrieb optimieren. Typische Größen liegen bei 50-200 Liter pro kW Heizleistung.
Propan (R290)
Propan (R290) ist ein natürliches Kältemittel mit sehr niedrigem Treibhauspotential (GWP = 3) und wird zunehmend in Wärmepumpen eingesetzt. Es ist brennbar, aber in geringen Mengen sicher verwendbar. Propan-Wärmepumpen erreichen hohe Effizienzwerte und sind langfristig verfügbar, da keine synthetischen F-Gase verwendet werden. In Österreich gewinnen sie aufgrund der F-Gas-Verordnung und Umweltaspekten an Bedeutung. Die Sicherheitsbestimmungen erfordern besondere Aufstellungsbedingungen und qualifizierte Kältetechniker.
R
Radiatoren
Radiatoren (Heizkörper) können auch mit Wärmepumpen betrieben werden, erfordern aber meist höhere Vorlauftemperaturen als Flächenheizungen. Für optimale Effizienz sollten sie überdimensioniert oder durch größere Modelle ersetzt werden, um mit niedrigeren Temperaturen (45-55°C) auszukommen. In österreichischen Altbausanierungen werden oft bestehende Radiatoren durch Niedertemperatur-Radiatoren ersetzt oder Hochtemperatur-Wärmepumpen eingesetzt. Die Kombination ist weniger effizient als Flächenheizungen, aber oft kostengünstiger umzusetzen.
S
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
Der SCOP ist eine europaweit einheitliche Kennzahl für die saisonale Effizienz von Luftwärmepumpen über eine ganze Heizperiode. Er berücksichtigt verschiedene Betriebszustände und Teillastverhalten bei unterschiedlichen Außentemperaturen. In Österreich wird der SCOP für verschiedene Klimazonen berechnet (Durchschnitts-, kältere und wärmere Zone). Er ist aussagekräftiger als der COP, da er reale Betriebsbedingungen besser abbildet. Für EU-Energielabel und Förderungen ist der SCOP oft entscheidend.
Schallschutz
Schallschutz ist bei Wärmepumpen besonders wichtig, da sie kontinuierlich arbeiten und Nachbarn stören können. In Österreich gelten die ÖNORM S 5021 und örtliche Lärmschutzverordnungen mit Grenzwerten zwischen 30-45 dB(A) nachts. Maßnahmen sind schalloptimierte Geräte, korrekte Aufstellung mit Abständen, Schallschutzhauben oder -wände und Körperschalldämmung. Besonders bei Luftwärmepumpen in dicht bebauten Gebieten ist eine lärmtechnische Planung wichtig.
Smart Grid Ready
Smart Grid Ready bezeichnet die Fähigkeit einer Wärmepumpe, mit intelligenten Stromnetzen zu kommunizieren und ihren Betrieb entsprechend den Netzerfordernissen oder Strompreisen anzupassen. Die Steuerung erfolgt über standardisierte Schnittstellen (SG Ready Label mit 4 Betriebszuständen). In Österreich wird diese Funktion für die Integration erneuerbarer Energien und Netzstabilität immer wichtiger. Smart Grid Ready Wärmepumpen können bevorzugt bei PV-Überschuss oder günstigen Strompreisen laufen.
Sole
Sole ist die Wärmeträgerflüssigkeit in Erdwärmeanlagen, bestehend aus Wasser und Frostschutzmittel (meist Glykol). Sie zirkuliert in den Erdkollektoren oder Erdsonden und transportiert die Erdwärme zur Wärmepumpe. In Österreich werden meist umweltverträgliche Frostschutzmittel auf Basis von Monoethylenglykol verwendet, die bis -15°C frostfrei bleiben. Die Sole-Konzentration wird je nach örtlichen Klimabedingungen angepasst. Regelmäßige Kontrollen des Frostschutzes und pH-Werts sind für den störungsfreien Betrieb wichtig.
Sole-Wasser-Wärmepumpe
Sole-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Erdwärme über Erdkollektoren oder Erdsonden als Wärmequelle. Sie zeichnen sich durch konstante Quelltemperaturen und hohe Jahresarbeitszahlen (4,0-5,5) aus. In Österreich sind sie sehr beliebt wegen der zuverlässigen Funktion und der Möglichkeit zur passiven Kühlung. Je nach System ist eine wasserrechtliche Bewilligung oder Anzeige erforderlich. Sie arbeiten leiser als Luftwärmepumpen und sind weniger wetterabhängig, erfordern aber höhere Investitionskosten für die Erdwärmequelle.
Split-Wärmepumpe
Split-Wärmepumpen bestehen aus einem Außengerät (Verdampfer und Kompressor) und einem Innengerät (Verflüssiger), die über Kältemittelleitungen verbunden sind. Diese Bauweise ermöglicht optimale Aufstellung des Außengeräts und geringere Rohrleitungsverluste. In Österreich sind sie besonders bei Renovierungen beliebt, da das Innengerät platzsparend im Keller installiert werden kann. Die Installation erfordert einen Kältetechniker für die Kältemittelleitungen. Split-Systeme bieten oft bessere Effizienz als Monoblock-Geräte.
Stromverbrauch Wärmepumpe
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt von der Heizlast, der Effizienz (JAZ) und den Betriebsstunden ab. Für ein typisches Einfamilienhaus in Österreich liegt er bei 3.000-6.000 kWh/Jahr. Bei einer JAZ von 4,0 werden aus 1 kWh Strom 4 kWh Wärme erzeugt. Moderne Wärmepumpen mit Inverter-Technologie passen ihren Stromverbrauch dem aktuellen Bedarf an. Die Kombination mit PV-Anlagen kann den Eigenverbrauchsanteil erhöhen und die Betriebskosten senken.
T
Takten
Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe bei geringem Wärmebedarf. Es führt zu ineffizientem Betrieb, höherem Verschleiß und schlechteren Jahresarbeitszahlen. Ursachen sind Überdimensionierung, fehlender oder zu kleiner Pufferspeicher oder ungeeignete Regelung. In Österreich wird das Takten durch korrekte Dimensionierung, Pufferspeicher und Inverter-Technologie minimiert. Moderne Wärmepumpen mit modulierender Leistung können sich besser an den aktuellen Bedarf anpassen.
Tiefenbohrung
Tiefenbohrungen für Erdsonden reichen in Österreich meist 80-150 m tief und erschließen die konstante Erdwärme. Die Bohrung erfolgt mit speziellen Bohrgeräten, danach werden U-Rohre eingebaut und der Ringraum verpresst. In Österreich ist meist eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich, da Grundwasserschichten durchfahren werden. Die Bohrung muss von zertifizierten Unternehmen durchgeführt werden. Pro kW Heizleistung werden etwa 15-20 m Bohrtiefe benötigt, abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs.
Trinkwarmwasser
Trinkwarmwasser ist das auf 45-60°C erwärmte Trinkwasser für Küche, Bad und Sanitär. Wärmepumpen können effizient Trinkwarmwasser bereiten, entweder in einem separaten Warmwasserspeicher oder einem Kombispeicher. Wichtig sind ausreichende Temperaturen für die Legionellenprophylaxe und eine gut gedämmte Warmwasserverteilung. In Österreich wird die Trinkwassererwärmung mit Wärmepumpen besonders gefördert, da sie fossile Brennstoffe ersetzt und hohe Effizienz erreicht.
V
Verdampfer
Der Verdampfer ist der Wärmetauscher, in dem das Kältemittel die Umweltwärme aufnimmt und dabei vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Bei Luftwärmepumpen ist es ein Lamellen-Rohr-Wärmetauscher im Außengerät, bei Erdwärmepumpen ein Plattenwärmetauscher im Innengerät. Die Größe und Konstruktion des Verdampfers beeinflussen die Effizienz wesentlich. Bei Luftwärmepumpen kann sich bei niedrigen Temperaturen Eis bilden, das durch automatische Abtauzyklen entfernt wird.
Verflüssiger
Der Verflüssiger (Kondensator) ist der Wärmetauscher, in dem das heiße gasförmige Kältemittel seine Wärme an das Heizungswasser abgibt und dabei wieder verflüssigt. Er ist meist als Plattenwärmetauscher ausgeführt und befindet sich im Innengerät der Wärmepumpe. Die Effizienz des Verflüssigers hängt von der Temperaturdifferenz zwischen Kältemittel und Heizwasser ab. Niedrige Heizwassertemperaturen verbessern die Effizienz der gesamten Wärmepumpe erheblich.
Vorlauftemperatur
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen fließt. Sie sollte bei Wärmepumpen möglichst niedrig sein, um hohe Effizienz zu erreichen. Optimal sind 35°C bei Fußbodenheizungen, 45-55°C bei großen Radiatoren. In Österreich wird bei der Planung auf niedrige Vorlauftemperaturen geachtet, da jedes Grad weniger die Effizienz deutlich verbessert. Moderne Wärmepumpen regeln die Vorlauftemperatur witterungsgeführt über die Heizkurve.
W
Wärmepumpen-Boiler
Wärmepumpen-Boiler sind kompakte Systeme speziell für die Warmwasserbereitung, bestehend aus einer kleinen Wärmepumpe und einem integrierten Speicher. Sie nutzen meist Raumluft oder Außenluft als Wärmequelle und erreichen Jahresarbeitszahlen von 2,5-3,5. In Österreich sind sie ideal für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden oder als Ergänzung zu anderen Heizsystemen. Sie können auch zur Raumluftkühlung und -entfeuchtung beitragen und sind besonders effizient in Kombination mit PV-Anlagen.
Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Wasser-Wasser-Wärmepumpen nutzen Grundwasser, Oberflächenwasser oder Abwasser als Wärmequelle. Sie erreichen die höchsten Jahresarbeitszahlen (5,0-6,0), da Wasser ganzjährig relativ konstante Temperaturen aufweist. In Österreich ist meist eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich und ausreichende Wassermengen und -qualität müssen vorhanden sein. Sie eignen sich besonders für größere Objekte und können auch sehr effizient zur Kühlung genutzt werden. Die Investitionskosten für Brunnen oder Wasserzuleitungen sind höher als bei anderen Systemen.
Witterungsgeführte Regelung
Die witterungsgeführte Regelung passt die Vorlauftemperatur der Heizung automatisch an die Außentemperatur an. Je kälter es wird, desto höher wird die Vorlauftemperatur eingestellt. Dies erfolgt nach einer einstellbaren Heizkurve und ermöglicht energieeffizienten Betrieb ohne Komfortverlust. In Österreich ist sie bei modernen Wärmepumpen Standard und wichtig für optimale Effizienz. Sie kann durch Raumtemperaturmessung verfeinert und durch prädiktive Algorithmen erweitert werden, die Wettervorhersagen berücksichtigen.
Z
Zweistufige Wärmepumpe
Zweistufige Wärmepumpen haben zwei Kompressoren oder einen zweistufigen Kompressor und können ihre Leistung in zwei Stufen schalten. Dies reduziert das Takten bei geringem Wärmebedarf und verbessert die Effizienz gegenüber einstufigen Geräten. Sie sind eine kostengünstige Alternative zu stufenlos regelbaren Inverter-Wärmepumpen. In Österreich werden sie bei kleineren bis mittleren Leistungen eingesetzt, wenn eine einfache Leistungsanpassung genügt. Moderne Inverter-Systeme sind jedoch meist die bessere Wahl.